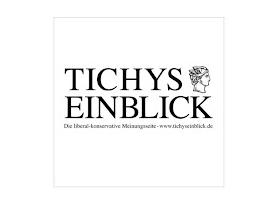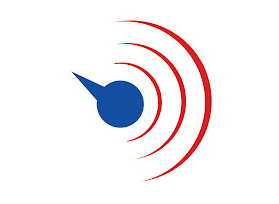Liebe Besucherinnen und Besucher der WerteUnion,
wir arbeiten daran, unsere Parteiseite zu verbessern und für Sie zugänglich zu machen. Sie befindet sich noch im Aufbau und wir freuen uns darauf, Ihnen in Kürze eine informative und ansprechende Plattform bieten zu können. Schon bald werden Sie hier alle wichtigen Informationen über unsere Partei finden. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!Möchten Sie die WerteUnion unterstützen?
Wenn Sie die WerteUnion unterstützen möchten, freuen wir uns über jede Spende. Besuchen Sie einfach unsere Webseite und folgen Sie den Anweisungen zur Spende. Zusammen können wir positive Veränderungen bewirken und eine bessere Zukunft für alle schaffen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!Politikwende: Jetzt! Freiheit, Werte und Familie
Veranstaltung

Politikwende: Jetzt! Freiheit, Werte und Familie
30. April 2024, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)
Siegen, Siegerlandhalle, Hüttensaal, Koblenzer Str. 151, 57042 Siegen
Referenten:
Dr. Hans-Georg Maaßen (Jurist, Präsident des Bundesverfassungsschutzes a.D. und Vorsitzender der Partei WerteUnion)
Sylvia Pantel (Ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages und Geschäftsführerin der „Stiftung für Familienwerte“)

Migrationswende: Jetzt! Alles hat seine Grenze.
6. Mai 2024, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)
Borna, Bürgerhaus Goldener Stern, Markt 1, 04552 Borna
Referenten:
Dr. Hans-Georg Maaßen (Jurist, Präsident des Bundesverfassungsschutzes a.D. und Vorsitzender der Partei WerteUnion)
Dr. Gerhard Papke (Landtagsvizepräsident Nordrein-Westfalen a.D. und Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft e.V.)

Dr. Hans-Georg Maaßen & Prof. Dr. Stefan Homburg
2. Juni 2024, 16 Uhr (Einlass 14:30 Uhr)
Chemnitz, c/o56 Hotel, Salzstr. 56, 09113 Chemnitz
Referenten:
Dr. Hans-Georg Maaßen „Politikwende: Jetzt! Freiheit statt Sozialismus“
Prof. Dr. Stefan Homburg „Krisenmodus: Corona, Klima, Rezession“
AKTUELLE
Nachrichten
Wir stehen für eine
freiheitliche Politik
Mitglied werden
Engagieren Sie sich für die Zukunft – werden Sie Parteimitglied!
Antrag, Satzung, Beitragsordnung
Zum Antragunser
Gründungsprogramm
Gemeinsam für Grundwerte –
Unser Programm, unsere Zukunft!
Lesen Sie hier unser Gründungsprogramm
Jetzt lesenDer Bundesvorstand
Gemeinsam führen, gemeinsam gestalten – Unser Vorstand, unser Antrieb!
Der Bundesvorstand
Jetzt informierenLANDTAGSWAHLEN
2024
coming soon